
Informatiker Och: Ein Affront für jeden
Linguisten
Ein deutscher Forscher hat eines der
ersten alltagstauglichen Übersetzungsprogramme entwickelt. Brachiale
Rechenkraft verhilft der Google-Software zu verblüffend guten Ergebnissen.
Es ist ein gutes Zeichen, wenn der Schöpfer
einer Software diese auch endlich selbst benutzt. In Japan war Franz Och jüngst
auf Reisen. Im Restaurant zückte er sein Handy und entschlüsselte die
Speisekarte. Auch Lokalnachrichten las er ohne Mühe. Denn die Übersetzungen
erhielt er in Sekunden.
Seit
sechs Jahren entwickelt der 38-Jährige im Google-Hauptquartier
im kalifornischen Mountain View das Übersetzungsprogramm "Google Translate",
"und bislang habe ich es eigentlich nie wirklich selbst benutzt", räumt
Och ein. Doch nun der Sinneswandel: "Ich bin sehr glücklich über das, was
wir erreicht haben."
Der Deutsche ist der heimliche Star einer
Software-Branche, die kein geringeres Ziel hat, als die globalen Sprachbarrieren
einzureißen. Och ringt für Google mit Schachtelsätzen, Konjunktiven und
Hilfsverben. Das Resultat ist ein Affront für jeden Linguisten. Denn nicht
Sprach-Know-how, sondern brachiale Rechenkraft erlaubt die maschinelle
Dolmetscherei.
52 Sprachen beherrscht das System bereits. Die
Datenbanken für 296 weitere sind gleichsam im Rohbau. Unter ihnen finden sich
Exoten wie Sardisch, Westfriesisch oder Zulu.
"Maschinelle Übersetzung ist auf einer
neuen Stufe angekommen"
Komplette Internetseiten, Diplomarbeiten,
selbst Liebesbriefe übersetzt "Google Translate" im Handumdrehen -
und liefert dabei oftmals verblüffend brauchbare Ergebnisse. Für Google liegt
der Nutzen auf der Hand: Noch mehr Internetsurfer als bislang lassen sich mit
einer derart nützlichen und zudem kostenlosen Anwendung auf die Website der
Firma locken.
"Maschinelle Übersetzung ist auf einer
neuen Stufe angekommen", schwärmt Och, "die Leute setzen unser
Programm inzwischen massiv ein; die Software hat die reale Welt erreicht."
"Was Google hier macht, ist sehr
beeindruckend", bestätigt Alon Lavie von der Carnegie Mellon University in
Pittsburgh. Der Informatiker sieht die gesamte Branche in Bewegung. Der Markt für
Übersetzungssoftware wachse rapide: "Es sind sehr aufregende Zeiten."
Die Epoche der maschinellen Übersetzung ist
angebrochen. Programme wie "Google Translate" weisen den Weg in eine
Zukunft, in der jedermann auf Knopfdruck in fremden Zungen sprechen kann. Das
ultimative Ziel der Sprachtüftler ist eine elektronische Version jenes
Babelfischs, den der britische Autor Douglas Adams in seinem
Science-Fiction-Klassiker "Per Anhalter durch die Galaxis" erfand: Ins
Ohr eingesetzt, übersetzt die blutegelartige Kreatur jede Sprache simultan.
Selbst die krude Poesie der Vogonen kann Romanheld Arthur Dent verstehen.
"Wörter haben häufig mehrere
Bedeutungen, und die Zahl der Kombinationen ist schier unendlich"
So weit haben es die Entwickler in der Realität
zwar noch nicht gebracht. Doch schon gibt es iPhone-Apps wie "Jibbigo",
das gesprochenes Englisch wieselflink ins Spanische übersetzt. Schöpfer der
Software ist Alex Waibel, Informatiker an der Universität Karlsruhe und an der
Carnegie Mellon University. Waibel lässt bereits viele seiner Vorlesungen von
Rechnern simultan übersetzen. Auch an Parlamentsdebatten testete er die Technik
schon.
Dabei
war der Dolmetscher aus dem Computerlabor lange ein kühner Traum. Woher etwa
soll die Maschine wissen, dass beim Englischen "breaking records"
keine Schallplatten zerdeppert werden? In dem Satz "wir treffen uns im
Schloss" wiederum muss die Software die Vokabel "Schloss" mit
"castle" übersetzen und keinesfalls mit "lock" (Türschloss),
was offensichtlich ziemlicher Blödsinn wäre.
Lange Zeit versuchten die Informatiker, den
Programmen derlei Weltwissen über ein komplexes Regelwerk einzubimsen. Doch
selbst bei tadellos formulierten Texten geriet die Software oftmals in fröhliches
Delirieren. Einen "Alptraum" nennt etwa Swamy Viswanathan von der
US-Firma Language Weaver den Versuch, beispielsweise die englische Sprache mit
all ihren Nuancen in Regeln zu pressen. "Wörter haben häufig mehrere
Bedeutungen, und die Zahl der Kombinationen ist schier unendlich", klagt
Viswanathan.
Die Experten von Language Weaver verfolgten
daher schon früh ein anderes Konzept. Sie fütterten ihre Systeme mit unzähligen
Texten aus dem Internet, die bereits mehrsprachig vorlagen. Der Ansatz der
Spezialisten: Fast jeder Satz, jede Phrase ist längst mehrfach übersetzt
worden. Reine Statistik reicht daher aus, um ein Sprachkonstrukt zu entschlüsseln.
2. Teil: Och hat dieses statistische Verfahren
für Google inzwischen perfektioniert
Um etwa das Beispiel "wir treffen uns im
Schloss" zu deuten, fahndet das Programm in seiner Datenbank nach Texten,
in denen "treffen" und "Schloss" nah beieinanderstehen. Dann
durchforstet es die Übersetzungen dieser Texte und findet dort häufig das Wort
"castle". Daher gibt die Maschine "we meet in the castle"
und nicht "we meet in the lock" aus.
Och hat dieses statistische Verfahren für
Google inzwischen perfektioniert. Schon während seiner Promotion spezialisierte
sich der Franke auf Spracherkennung. Danach ging er an die University of
Southern California. Bald interessierte sich das Pentagon für seine Arbeit.
Nach 9/11 wollten die US-Geheimdienstler arabische Zeitungen, Chatrooms und
Websites verschärft kontrollieren.
Doch 2004 lockte Google den Sprachbezwinger
nach Mountain View. Dort kommt Och seither die gewaltige Rechenleistung des
Internetimperiums zugute. Zahlen mag Och nicht nennen. Für viele Sprachpaare
lagern jedoch Billionen Einträge in den Google-Datenbanken. Wichtige Ressourcen
für das Wortarchiv sind etwa die in zahlreiche Sprachen übersetzte Bibel,
Transkripte der Vereinten Nationen oder die 23-sprachigen EU-Dokumente.
Solcherlei "Paralleltexte" sind so
etwas wie der Stein von Rosette des Digitalzeitalters: Das antike Vorbild trägt
dieselbe Inschrift in Griechisch, Demotisch und in Hieroglyphen. 1822 lüftete
der Ägyptologe Jean-Francois Champollion mit ihrer Hilfe das Geheimnis der
Hieroglyphen.
Genauso macht es nun Ochs Software. Die Stärken
des Systems: Ein und derselbe Programmcode funktioniert für alle Sprachen. Es
muss nur genug übersetzter Text vorliegen.
Sawaf kritisiert zudem, dass Ochs System nur
online funktioniert.
Ein Buchstabenfresser als Universaldolmetscher?
Viele Linguisten halten derlei Rechenschiebertricks für Tinnef. "Die
statistische Übersetzung stößt schnell an ihre Grenzen", sagt etwa der
Sprachwissenschaftler Martin Kay von der Stanford University, "der Ansatz
ignoriert die komplexe Struktur von Sprache." Bei der im Deutschen üblichen
Stellung von Vollverb und Hilfsverb etwa versage die Technik. Auch an der
Unterscheidung von Subjekt und Objekt habe sie zu knapsen.
"Für wirklich gute Ergebnisse müssen wir
tiefer in die Sprache eintauchen", sagt auch Hassan Sawaf, Chefentwickler
der US-Software-Schmiede Apptek. Die Firma geht einen Mittelweg. Neben
statistischen Algorithmen nutzt Sawaf auch klassische Grammatikregeln: "Das
verbessert den Satzbau und die Verständlichkeit erheblich."
Sawaf kritisiert zudem, dass Ochs System nur
online funktioniert: "Wer offline arbeitet, kann 'Google Translate'
vergessen." Auch Waibel ist skeptisch. "Stellen Sie sich vor, Sie sind
im Ausland, wollen sich mit einem Verkäufer unterhalten und müssen erst mal
ein Netz suchen und dann auch noch hohe Roaming-Gebühren bezahlen - praktikabel
ist das nicht."
Tatsächlich stellt die Netzabhängigkeit eine
der größten Schwächen der Google-Übersetzungsmaschine dar. Doch die
Kalifornier weichen nicht von ihrem Kurs ab. Schon entwickeln sie eine spezielle
Programmversion mit integrierter Spracherkennung für das hauseigene
Handy-Betriebssystem "Android". Und bald soll es auch möglich sein,
Texte auf Fotos blitzschnell übersetzen zu lassen. So könnte der ortsunkundige
Reisende künftig in China das Schild mit der Aufschrift ablichten - und wüsste
umgehend, dass er sich auf dem Weg nach Peking befindet.
"Wer kein Englisch spricht, kann nur einen
Bruchteil des Internets nutzen"
Eine weitere Gelddruckmaschine für den
Internetgiganten scheint also heranzureifen. Doch Och winkt ab. Wie viele
Google-Mitarbeiter wähnt er sich lieber auf einem Feldzug für Freiheit und
Gleichheit im Netz. "Wer kein Englisch spricht, kann nur einen Bruchteil
des Internets nutzen", sagt er. Es gelte, die Vielfalt allen zugänglich zu
machen.
Ein Indiz für die hehren Absichten des
Programmierers gibt es immerhin. Och und sein Team haben eine Spezialsoftware
entwickelt, mit deren Hilfe Dolmetscher auf eigene Faust Übersetzungen in das
System einspeisen können - und zwar auch für äußerst exotische Idiome wie
die Bantusprache Xhosa, die Sprache der in Japan lebenden Ainu oder die
Inuit-Sprache Inuktitut. Auf diese Weise wollen die Software-Entwickler auch
jenen Zungen Gehör verschaffen, die bereits in Vergessenheit zu geraten drohen.
Der neuseeländische Computeringenieur Te Taka Keegan von der University of
Waikato testete das Programm bereits für die Sprache der Maori. Sechs Monate
verbrachte Keegan kürzlich bei Google, um auszuloten, ob das digitale
Sprachenmirakel aus Mountain View das Idiom der neuseeländischen Ureinwohner
vor dem Verschwinden bewahren könnte. Seine Erfahrungen sind durchweg positiv.
"Die Zahl und Qualität der Maori-Übersetzungen
wächst mit Hilfe dieses Werkzeugs ständig", berichtet Keegan. Ein
digitales Archiv entstehe, das der Sprache erheblichen Auftrieb verleihe.
"Unsere Kinder wachsen in eine digitale
Welt hinein", sagt Keegan. "Nur wenn wir es schaffen, Maori zum Teil
dieser Welt zu machen, wird die Sprache überleben."
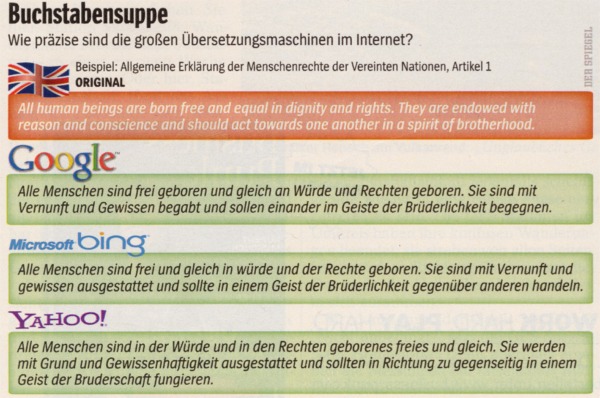
__________________________________________________THE BOTTOM LINE________________________________________________________